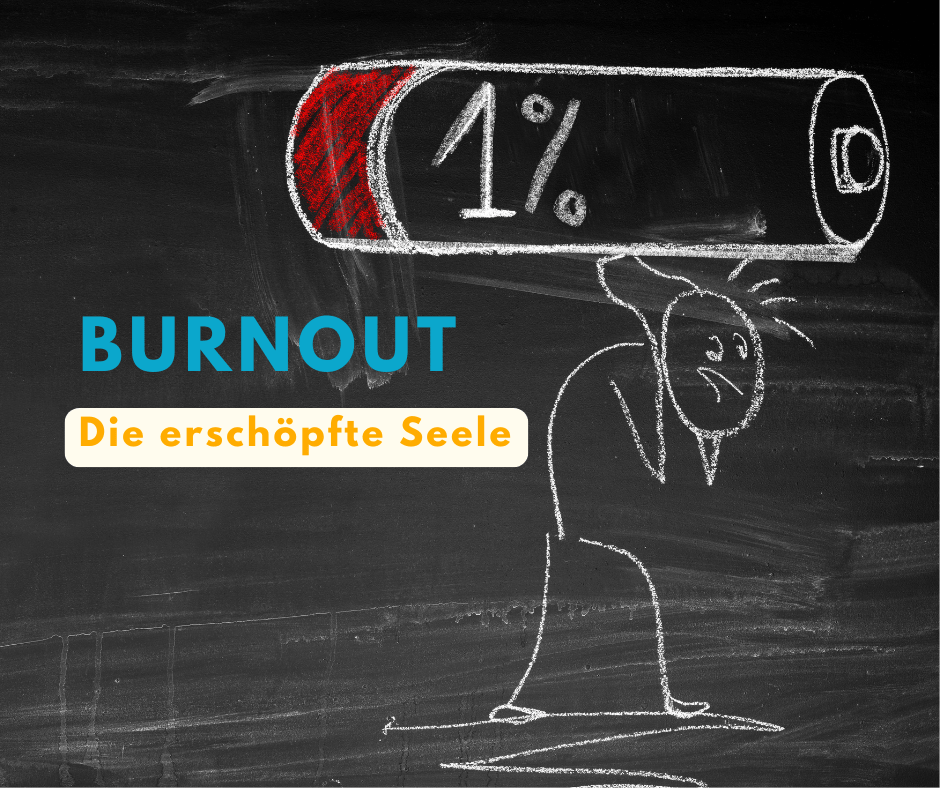Burnout:
Die erschöpfte Seele
Ein Beitrag zur Großen Fastenzeit 2025
Von Pfr. Dr. Diradur Sardaryan
Gemeindepfarrer
Die Kerzen des Abendandachts (Hskum) flackern sanft in der Dunkelheit. Ihr Licht wirft tanzende Schatten an die Wände der Kirche, während die Gesänge der alten armenischen Scharakans den Raum erfüllen. Am Ende der langen Bankreihe sitzt ein Mann mittleren Alters. Sein Gesicht zeigt eine Erschöpfung, die tiefer geht als körperliche Müdigkeit. Er ist da, aber doch nicht anwesend – seine Gebete erreichen kaum seine Lippen, und sein Blick ist leer. Die Flammen spiegeln sich in seinen Augen, aber dort findet sich kein Widerschein mehr.
Die verborgene Pandemie unserer Zeit
Burnout – ein Wort, das in unseren Gemeinschaften immer häufiger zu hören ist. Es beschreibt einen Zustand emotionaler, körperlicher und geistiger Erschöpfung, der durch anhaltenden Stress entsteht. In Deutschland leiden nach aktuellen Studien etwa 25% der Erwerbstätigen unter schweren Burnout-Symptomen. Die WHO hat Burnout 2019 als „berufliches Phänomen“ in die internationale Klassifikation von Krankheiten aufgenommen. Es ist die verborgene Pandemie unserer Zeit, die nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch das seelische Wohlbefinden und die spirituelle Verbindung des Menschen bedroht.
Besonders in unseren armenischen Diasporagemeinden wird dieses Phänomen immer deutlicher sichtbar, auch wenn es nicht ausdrücklich untersucht wurde. Doch aus meiner Praxis als Gemeindepfarrer merke ich, dass viele Gemeindemitglieder unter einem dreifachen Druck stehen: Sie jonglieren mit den Anforderungen eines anspruchsvollen Berufslebens, den Verpflichtungen gegenüber der Familie und dem inneren Antrieb, ihre kulturelle und religiöse Identität in einer fremden Umgebung zu bewahren. Diese Mehrfachbelastung führt häufig zu einer Überforderung, die sich schleichend in den Alltag einschreibt. Der Wunsch, sowohl den Erwartungen der modernen Arbeitswelt als auch den Traditionen der Vorfahren gerecht zu werden, schafft eine Spannung, die selten offen ausgesprochen wird, aber tief im Leben der Betroffenen wirkt. In einer Gesellschaft, die Leistung und ständige Verfügbarkeit glorifiziert, bleibt wenig Raum für Regeneration – ein Umstand, der die Seele allmählich erschöpft.
Die Auswirkungen dieser Entwicklung reichen über das Individuum hinaus und betreffen die Gemeinschaft als Ganzes. In unseren Kirchen begegnen wir Menschen, die zwar physisch anwesend sind, aber innerlich abwesend wirken – unfähig, die Kraft aus den vertrauten Riten und Gebeten zu schöpfen, die einst Halt gaben. Diese Entfremdung von der spirituellen Quelle ist nicht nur ein Symptom von Burnout, sondern auch ein Alarmzeichen dafür, dass unsere Lebensweise mit den tiefen Werten unserer armenisch apostolischen Tradition in Konflikt geraten ist. Hier setzt die Große Fastenzeit an: Sie bietet nicht nur eine Zeit der Buße, sondern auch eine Gelegenheit, diesen zerstörerischen Kreislauf zu durchbrechen und die Balance zwischen äußerer Aktivität und innerer Sammlung wiederherzustellen.
Der ausgebrannte Mensch:
Anzeichen erkennen
Burnout zeigt sich nicht plötzlich, sondern entwickelt sich schleichend. Die Symptome sind vielfältig:
- Chronische Erschöpfung, die durch Schlaf nicht besser wird
- Entfremdungsgefühle gegenüber Arbeit und Familie
- Zynismus und emotionale Distanz
- Verringerte Leistungsfähigkeit trotz größerer Anstrengung
- Körperliche Symptome wie Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme
- Vernachlässigung des sozialen Lebens und spiritueller Praktiken
Die geistige Dimension des Burnouts wird oft übersehen, manifestiert sich aber deutlich: Der Zugang zum Gebet wird schwieriger, Surb Patarag wird zur mechanischen Pflichtübung, die innere Verbindung zu Gott scheint unterbrochen. Wie der Prophet Elija unter dem Ginsterstrauch fühlt sich die Seele zu erschöpft, um weiterzugehen.
Burnout ist mehr
als nur ein medizinisches Problem
Die ostkirchliche Tradition bietet einen einzigartigen Blick auf das Phänomen Burnout, indem sie es nicht nur als medizinische oder psychologische Herausforderung betrachtet, sondern als eine Krise der Seele, die tief in der menschlichen Existenz verwurzelt ist. Die Kirchenväter kannten den Begriff „Burnout“ nicht, doch sie beschrieben verwandte Zustände wie die acedia – eine geistige Trägheit und Trockenheit, die den Menschen von Gott und seiner Bestimmung entfernt. Der heilige Johannes Cassian, ein bedeutender Vertreter der frühchristlichen Spiritualität, sprach vom „Dämon des Mittags“, einem Zustand tiefer Sinnlosigkeit und Erschöpfung, der besonders in der Lebensmitte oder in Zeiten intensiver Prüfung auftritt. Dieser „Dämon“ wird in Psalm 90,6 erwähnt („vor der Pest, die am Mittag vernichtet“) und attackiert die Seele, wenn die Last des Tages am schwersten wiegt.
Johannes Cassian und Evagrius Ponticus, ein weiterer maßgeblicher Theoretiker des Mönchtums, schildern diese Versuchung eindrucksvoll anhand des Lebens eines Einsiedlers in seiner Zelle. Sie erzählen von einem Mönch, der in der Einsamkeit seiner Behausung sitzt, gequält von einem hartnäckigen Gefühl der Trostlosigkeit und Langeweile – der acedia. Besonders zur Mittagszeit, wenn die Sonne im Zenit steht und die Hitze unerträglich wird, überfällt ihn dieser „Dämon des Mittags“. Dem Mönch erscheint die Zeit wie erstarrt: Das Sonnenlicht brennt unbarmherzig herab, der Tag scheint kein Ende zu nehmen, und jede Minute dehnt sich zur Ewigkeit. Er erhebt sich wiederholt, tritt ans Fenster seiner Zelle und späht hinaus in der Hoffnung, einen Besucher zu erblicken – jemanden, der ihn von seiner Einsamkeit erlöst oder die Stunde der Mahlzeit näherbringt. Doch niemand kommt. In seinem Geist flüstert der Dämon ihm ein, dass die Brüder kein Erbarmen mehr mit ihm haben, dass sie ihn vergessen oder bewusst meiden.
Die innere Unruhe wächst. Wenn der Mönch kürzlich von einem Mitbruder verärgert wurde, nutzt der Dämon diese Wunde, um seine Abneigung zu verstärken und alte Kränkungen wieder aufleben zu lassen. Bald beginnt der Mönch, seine Umgebung zu verachten: die monotone Arbeit, das ständige Lesen der Schriften, das eintönige Leben in der Zelle. Er fantasiert von anderen Orten, wo die Menschen freundlicher, die Arbeit leichter und die Lebensumstände angenehmer wären. Vielleicht, so überlegt er, könnte er ein nützlicheres Handwerk erlernen, eines, das weniger mühsam und ertragreicher ist. Hier, in dieser Ödnis, scheint er nur Zeit zu vergeuden – Zeit, die er nutzen könnte, um seinen Verwandten, Freunden oder den Bedürftigen zu helfen, ja sogar einer gottgeweihten Frau beizustehen. Wie viele Jahre soll er noch in dieser trostlosen Langeweile verharren? Schließlich sieht er nur zwei Auswege aus dieser Qual: entweder die Zelle zu verlassen und in die Welt zu fliehen oder sich dem Schlaf hinzugeben, um die Leere zu betäuben.
Doch Cassian und Evagrius mahnen eindringlich, dass Flucht keine Heilung bringt. „Während der Versuchungen“, schreibt Cassian, „soll man die Zelle nicht verlassen und sich plausible Ausreden einfallen lassen, sondern darin verbleiben, geduldig und mutig allen Angriffen widerstehen, insbesondere dem Dämon der Trostlosigkeit, der schwerer ist als alle anderen und die Seele gründlich prüft. Denn solche Kämpfe zu meiden, lehrt den Geist, unerfahren, furchtsam und zur Flucht geneigt zu sein.“ Die Lösung liegt nicht im Aufgeben, sondern im standhaften Ausharren, gestützt durch Gebet und Gemeinschaft.
Diese Schilderung ist eine eindringliche Parallele zum modernen Burnout. Wie der Mönch in seiner Zelle fühlen sich viele Menschen heute gefangen in einem Leben, das ihnen sinnlos erscheint – überfordert von Arbeit, die keine Erfüllung bringt, und einem Alltag, der keine Ruhe lässt. Die ständige Erreichbarkeit durch digitale Medien, die Verdichtung der Arbeit und die Verherrlichung von Produktivität verstärken diese Trostlosigkeit und machen sie zu einer strukturellen Herausforderung unserer Zeit. In diesem Kontext gewinnt die Große Fastenzeit eine neue, heilsame Bedeutung: Sie lädt dazu ein, nicht vor der inneren Leere zu fliehen, sondern sie mutig auszuhalten und durch den Rhythmus von Gebet, Verzicht und Reflexion in einen Raum der Erneuerung zu verwandeln.
Die Fastenzeit als Gegenentwurf
zur Beschleunigung
Die Große Fastenzeit lädt uns ein, bewusst aus dem Hamsterrad auszusteigen. Sie bietet einen strukturierten, jahrtausendealten Rhythmus der Entschleunigung und Neuausrichtung. Was ursprünglich als Vorbereitung auf die Taufe und als geistliche Reinigung konzipiert war, wird in unserer Zeit zu einer Schule der achtsamen Lebensführung:
- Reduktion statt Überfluss: Der Verzicht auf bestimmte Speisen trainiert die Fähigkeit, bewusst „Nein“ zu sagen – eine Kernkompetenz in der Burnout-Prävention.
- Gebet statt ständiger Aktivität: Die Gottesdienste der Fastenzeit und die Gebetszeiten schaffen Inseln der Stille in einem hektischen Alltag.
- Gemeinschaft statt Isolation: Die gemeinsamen Fastenübungen verbinden uns mit anderen und durchbrechen die Einsamkeit, die oft mit Burnout einhergeht.
- Reflexion statt Oberflächlichkeit: Die Fastenzeit fordert uns zu ehrlicher Selbstprüfung auf, die den Wurzeln der Erschöpfung auf den Grund geht.
Ein Gemeindemitglied, das selbst einen schweren Burnout durchlebt hat, berichtet: „Ich hatte alles dem Erfolg geopfert – meine Gesundheit, meine Beziehungen, sogar meinen Glauben. In der Fastenzeit fand ich zurück zu meinen Wurzeln. Die langen Gottesdienste, die anfangs wie eine zusätzliche Last wirkten, wurden zu Oasen der Stille. Im Verzicht entdeckte ich einen Reichtum, den ich in der Fülle nie gefunden hatte.“
Aus der Erschöpfung herausfinden
Die armenisch-orthodoxe Tradition bietet bewährte Hilfsmittel für Menschen im Burnout oder in der Gefahr, dorthin zu geraten, die sich mit modernen psychologischen Ansätzen fruchtbar verbinden lassen. Ergänzt wird dieser Ansatz durch die bewusste Gestaltung der Freizeit und die Förderung sinnvoller Selbstverwirklichung, etwa durch kreative Tätigkeiten wie Malen, Singen oder Basteln, die sowohl der Seele als auch dem Geist Erholung und Ausdruck verleihen.
Das Jesusgebet als Anker: Die wiederholte Anrufung „Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner“, synchronisiert mit dem Atem, schafft mitten im Alltag einen Raum der Ruhe. Diese Praxis, verwurzelt in der ostkirchlichen Spiritualität, bringt den Menschen in die Gegenwart und stärkt die Verbindung zu Gott – ein Aspekt, der im Burnout oft verloren geht. Moderne Psychologie ergänzt dies durch achtsame Atemtechniken, die nachweislich Stress reduzieren und die Selbstwahrnehmung fördern. Eine Synthese könnte das Jesusgebet (oder ein anderes Gebet der Kirchenväter) als spirituelle Achtsamkeit gestalten: eine Übung, die die Seele nährt und das Nervensystem beruhigt.
Die Gebetsecke (Surb) als Ruhepol: Die Einrichtung eines kleinen Gebetsbereichs zu Hause – mit der Bibel, Ikonen, einer Kerze und vielleicht Weihrauch – bietet einen konkreten Ort der Stille. Selbst wenige Minuten täglicher Verweilung dort wirken der Hektik des Alltags entgegen. Psychologische Ansätze unterstützen dies durch die Empfehlung eines „sicheren Raums“, der emotionale Stabilität fördert. Eine Integration könnte diesen Ort als dualen Rückzugsort nutzen: ein heiliger Raum für Gebet und zugleich ein Ort für kreative Betätigung, etwa das Zeichnen einer Ikone oder das Gestalten eines Gebetsbuchs, um spirituelle Kontemplation mit persönlichem Ausdruck zu verbinden.
Der Rhythmus des Surb Patarag: Die regelmäßige Teilnahme an der Göttlichen Liturgie (Surb Patarag) gibt dem erschöpften Menschen einen Rahmen, der größer ist als die eigene Erschöpfung. Der Gläubige darf sich in den jahrhundertealten Strom des Gebets hineinnehmen lassen, ohne selbst leisten zu müssen. Psychologisch betrachtet stärkt diese Gemeinschaftserfahrung das Zugehörigkeitsgefühl und reduziert Isolation. Eine Synthese könnte die Liturgie als „therapeutische Gemeinschaft“ rahmen, die durch gemeinsames Singen der Hymnen oder das Mitwirken an liturgischen Handarbeiten (z. B. Kerzenziehen) spirituelle Erneuerung mit sozialer und kreativer Interaktion vereint.
Die Beichte als Entlastung: Das Mysterium der Beichte schafft einen geschützten Raum, um Gefühle von Versagen, Scham und Selbstvorwürfen anzusprechen, und ermöglicht eine Neuausrichtung, die über Symptombehandlung hinausgeht. Moderne Psychotherapie, etwa die kognitive Verhaltenstherapie, bietet ähnliche Gespräche zur Umstrukturierung negativer Gedanken. Eine kombinierte Praxis könnte die Beichte mit therapeutischen Elementen anreichern: ein Prozess, der spirituelle Vergebung mit kognitiver Heilung verbindet, etwa durch das anschließende Schreiben oder Malen als Ausdruck der inneren Klärung.
Askese als Freiheitsübung: Die bewusste Einschränkung in der Fastenzeit – sei es beim Essen, bei digitalen Medien oder Konsumgewohnheiten – schult die Fähigkeit zur Selbstbegrenzung und wirkt der unfreiwilligen Überforderung des Burnouts entgegen. Psychologische Stressbewältigung betont ebenfalls die Bedeutung von Grenzen und Prioritäten. Eine Synthese könnte die Askese als bewusste Lebensstilintervention gestalten: ein spirituell motivierter Verzicht, der Raum für sinnvolle Freizeitgestaltung schafft, etwa durch das bewusste Einplanen von Zeit für kreative Tätigkeiten wie Basteln, die die innere Balance fördern.
Freizeitgestaltung und kreative Selbstverwirklichung: Die ostkirchliche Tradition betont die Bedeutung der Ruhe, die in der modernen Welt oft durch sinnvolle Freizeitaktivitäten konkretisiert werden kann. Malen, Singen oder Basteln sind nicht nur Ausdrucksmöglichkeiten, sondern auch Wege, die erschöpfte Seele zu heilen, indem sie Freude und Erfüllung jenseits von Leistungsdruck bieten. Psychologische Forschung zeigt, dass kreative Tätigkeiten das Wohlbefinden steigern, Stress abbauen und das Selbstwertgefühl stärken. Eine Synthese könnte diese Aktivitäten in die Fastenzeit integrieren: etwa das Malen von religiösen Motiven als meditative Praxis, das Singen von Psalmen zur Vertiefung des Gebets oder das Basteln von Kreuzen als Ausdruck von Glauben und Handwerkskunst. So werden Freizeit und Selbstverwirklichung zu einem heiligen Raum der Regeneration.
Die Gemeinde als Ort der Heilung
Als Diasporagemeinde haben wir eine besondere Verantwortung für unsere Mitglieder. Oft sind es gerade die aktivsten Gemeindemitglieder, die in die Burnout-Falle geraten – die, die neben Beruf und Familie auch noch das Gemeindeleben tragen. Folgende Ansätze können hilfreich sein:
- Anerkennung der Grenzen menschlicher Kraft, ohne Schuldgefühle zu erzeugen
- Schaffung von Entlastungsmöglichkeiten für überaktive Gemeindemitglieder
- Integration von Ruheelementen in Gemeindeaktivitäten, etwa durch Stille-Übungen
- Sensibilisierung für die Anzeichen von Überlastung
- Förderung einer Kultur der gegenseitigen Unterstützung statt des Einzelkämpfertums
Ein besonderes Augenmerk sollten wir auf Neuankömmlinge legen, die oft unter enormem Druck stehen, sich eine neue Existenz aufzubauen und gleichzeitig ihre kulturelle Identität zu bewahren.
Die Wiederentdeckung der Sonntagsruhe
In einer Zeit, in der Produktivität vergöttert wird, ist die bewusste Unterbrechung des Arbeitsrhythmus ein zutiefst geistlicher Akt. Die christliche Tradition des Sonntags – des Tages, an dem die Arbeit ruht – gewinnt heute eine neue Bedeutung. In der armenischen Tradition wird dieser Gedanke besonders in der Feier des Sonntags als „kleines Ostern“ lebendig.
Ein bewusst gestalteter Sonntag – beginnend mit Surb Patarag, gefolgt von Zeiten echter Erholung ohne digitale Ablenkung, vielleicht mit einem gemeinsamen Mahl im Kreis der Familie oder der Gemeinde – kann ein wirkungsvolles Gegenmittel gegen die ständige Geschäftigkeit sein.
Die Große Fastenzeit und aktives Gemeindeleben kann uns helfen, diese Kultur der heilsamen Unterbrechung wieder zu entdecken, nicht als zusätzliche Last, sondern als Weg in die Freiheit.
Die erschöpfte Seele und der barmherzige Gott
Der Mann in der Kirchenbank, von dem wir am Anfang sprachen, kommt seit einigen Wochen wieder regelmäßig zum Gottesdienst. Er hat begonnen, während der Fastenzeit mit dem Pfarrer zu sprechen. Langsam kehrt das Leben in seine Augen zurück. Er hat gelernt, seinen Selbstwert nicht an seiner Leistung zu messen, sondern an der unveräußerlichen Würde als Gottes Ebenbild. Er hat begonnen, die Stille nicht als bedrohliche Leere, sondern als nährenden Raum der Begegnung mit Gott zu erfahren.
Sein Weg ist nicht abgeschlossen, aber er hat eine neue Richtung gefunden. „Ich verstehe jetzt die Worte Christi besser“, sagt er leise nach dem Gottesdienst. „Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.“
Gebet für Erschöpfte
Barmherziger Gott,
Du siehst die Mühen Deiner Kinder.
Du kennst die Erschöpfung unserer Tage
und die Schwere, die auf unseren Schultern lastet.
Schenke uns die Gnade, innezuhalten und zu erkennen,
dass wir mehr sind als unsere Arbeit,
mehr als unsere Leistung,
mehr als unser Erfolg.
Lehre uns den heilsamen Rhythmus
von Anspannung und Entspannung,
von Aktivität und Kontemplation,
von Geben und Empfangen.
Erneuere die erschöpften Kräfte unserer Seele
durch Deine nie versiegende Gnade.
Amen.
Reflexionsfrage: Welche Gewohnheiten oder Überzeugungen in meinem Leben treiben mich in die Erschöpfung? Wo könnte ich in dieser Fastenzeit bewusst innehalten und einen neuen Rhythmus finden, der meine Seele nährt statt sie auszulaugen? Wann habe ich zuletzt Jesus Christus um Hilfe gebeten?
Infokasten: Hilfe bei Burnout
Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, unter Burnout-Symptomen leiden, ist professionelle Hilfe wichtig:
- Hausarzt als erste Anlaufstelle für medizinische Abklärung
- Psychotherapeutische Beratung
- Burnout-Selbsthilfegruppe
- Geistliche Begleitung durch den Gemeindepfarrer