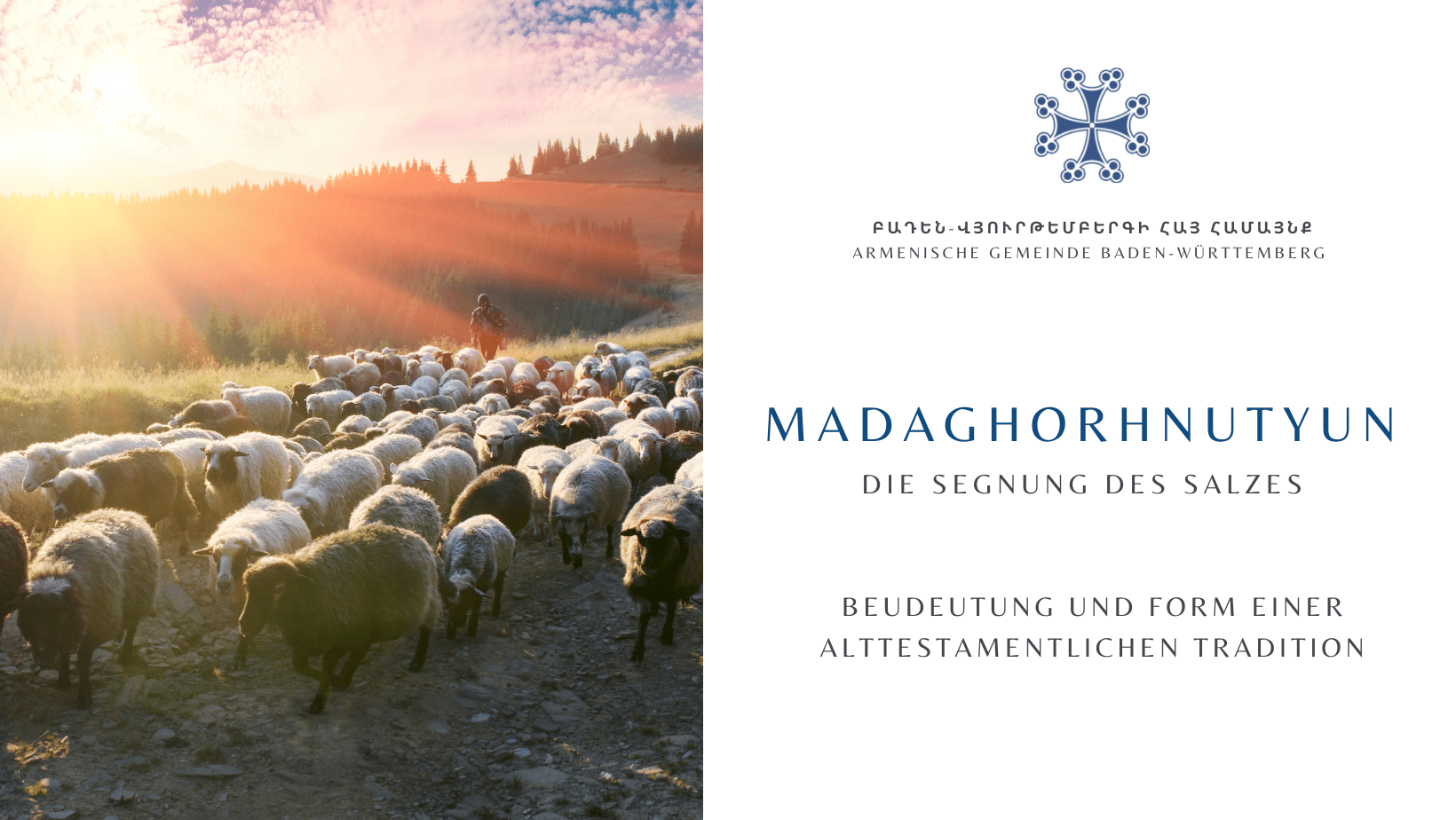Von der Schöpfung zur Auferstehung:
Christus als leidender Gottesknecht –
Die Bedeutung des Kreuzes
4. Woche, Donnerstag (27. März 2025):
Biblische Lesung für den Tag:
Jesaja 53:1-12; 1. Petrus 2:21-24
Das Paradox des leidenden Gerechten
„Er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Heil, durch seine Wunden sind wir geheilt.“ (Jesaja 53,5)
Diese prophetischen Worte, niedergeschrieben Jahrhunderte vor Christus, beschreiben mit erstaunlicher Präzision das Leiden des Messias. Das 53. Kapitel des Jesajabuches gehört zu den vier „Gottesknechtsliedern“ (Jes 42,1-9; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12), die eine rätselhafte Gestalt beschreiben – einen Gerechten, der freiwillig und stellvertretend leidet.
Während wir uns der Karwoche nähern, führt uns die heutige Betrachtung zum tiefsten Geheimnis des christlichen Glaubens: dem Kreuz Christi. Dieses Zeichen, das in der antiken Welt für Schande und Fluch stand, ist für Christen zum Symbol der Erlösung geworden. Das Kreuz steht im Zentrum des christlichen Glaubens, weil es die paradoxe Logik Gottes offenbart: Sieg durch Niederlage, Leben durch Tod, Herrlichkeit durch Hingabe.
In der armenischen Tradition hat das Kreuz eine besondere Bedeutung. Das steinerne Kreuz (khachkar) – oft kunstvoll verziert mit Lebensbaummotiven und Ewigkeitssymbolen – ist nicht nur ein Zeichen des Leidens, sondern auch der Auferstehung und des Lebens. Es verbindet die Tragödie des Karfreitags mit dem Triumph des Ostersonntags und erinnert uns daran, dass diese beiden Aspekte untrennbar zusammengehören.
Nach unserer Betrachtung des barmherzigen Samariters und der Heilung des blinden Bartimäus wenden wir uns nun dem Kern des Heilsmysteriums zu: Christus als dem leidenden Gottesknecht, der durch sein Leiden die Welt erlöst.
Die vier Dimensionen des leidenden Gottesknechtes
Das prophetische Bild des leidenden Gottesknechtes in Jesaja 53 entfaltet vier Dimensionen, die im Leben und Sterben Jesu ihre vollkommene Erfüllung finden:
1. Der Verachtete und Verworfene (Verse 2-3)
„Er hatte keine schöne und edle Gestalt, dass wir nach ihm geschaut hätten; und sein Aussehen war nicht so, dass wir Gefallen gefunden hätten an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut.“
Diese Worte beschreiben einen Messias, der nicht den weltlichen Erwartungen von Macht und Herrlichkeit entspricht. Er kommt nicht als triumphierender König, sondern als ein Mann der Schmerzen. In Jesus erfüllt sich diese Prophezeiung auf doppelte Weise: In seiner Menschwerdung verzichtet er auf seine göttliche Herrlichkeit, und in seinem Leiden wird er zum Gegenstand der Verachtung und des Spottes.
Maximus der Bekenner (ca. 580-662) sieht in dieser Selbstentäußerung (kenosis) das tiefste Geheimnis der Liebe Gottes. Gott selbst steigt herab in die Niedrigkeit der menschlichen Existenz, um sie von innen her zu verwandeln. Das Kreuz ist der Höhepunkt dieser Bewegung der Demut und Hingabe.
In der armenischen spirituellen Tradition wird diese Verworfenheit des Messias oft im Zusammenhang mit dem eigenen historischen Leiden des armenischen Volkes betrachtet – als Zeichen der Solidarität Gottes mit allen Leidenden und Unterdrückten.
2. Der stellvertretend Leidende (Verse 4-6)
„Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt.“
Hier entfaltet der Prophet das Prinzip der Stellvertretung: Der Gottesknecht leidet nicht für eigene Vergehen, sondern für die Sünden anderer. Er nimmt freiwillig die Last auf sich, die eigentlich die Menschheit tragen müsste.
In Christus erfüllt sich dieses Prinzip in vollkommener Weise. Der vollkommen Unschuldige trägt die Schuld der Sünder. Wie der Apostel Petrus schreibt: „Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen“ (1 Petr 2,24). Dies ist nicht eine juridische Transaktion, sondern ein Akt der tiefsten Solidarität und Liebe.
Der Kirchenvater Athanasius (ca. 298-373) drückt es in seinem Werk „Über die Menschwerdung des Wortes“ so aus: „Er wurde Mensch, damit wir vergöttlicht werden; er offenbarte sich im Körper, damit wir eine Vorstellung vom unsichtbaren Vater bekommen; er ertrug die Beleidigungen der Menschen, damit wir die Unsterblichkeit erben.“
3. Der schweigend Leidende (Verse 7-9)
„Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf.“
Das Bild des schweigenden Lammes ist besonders eindrücklich. Der Gottesknecht protestiert nicht gegen sein Leiden, sondern nimmt es in Stille an. Dieses Schweigen ist nicht Resignation, sondern eine tiefere Form der Souveränität – die Freiheit dessen, der sein Leiden bewusst annimmt.
Die Evangelien betonen das Schweigen Jesu während seines Prozesses und seiner Kreuzigung. Vor Pilatus, vor Herodes und am Kreuz antwortet er oft nicht auf Anklagen und Spott. Dieses Schweigen ist ein Zeichen seiner Würde und seiner freien Hingabe. Er stirbt nicht als Opfer der Umstände, sondern als einer, der sein Leben freiwillig hingibt.
Der heilige Ignatius von Antiochien (ca. 35-107) schreibt in seinem Brief an die Epheser: „Es ist besser zu schweigen und zu sein, als zu reden und nicht zu sein.“ Das Schweigen Christi am Kreuz ist kein leeres Schweigen, sondern ein Schweigen voller Gegenwart und Sein – das Schweigen des Wortes Gottes selbst, das in die Stille des Todes hinabsteigt.
4. Der im Leiden Siegende (Verse 10-12)
„Doch der HERR fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht. Nachdem er vieles ertrug, wird er Licht schauen und sich sättigen… Deshalb gebe ich ihm Anteil unter den Großen, und mit Mächtigen teilt er die Beute.“
Das vierte Lied des Gottesknechtes endet nicht mit Tod und Niederlage, sondern mit einem überraschenden Sieg. Der Knecht, der bis zum Äußersten gelitten hat, wird erhöht und gerechtfertigt. Sein Tod ist nicht das Ende, sondern der Durchgang zu einer höheren Form des Lebens.
In Christus erfüllt sich diese Prophezeiung in der Auferstehung. Das Kreuz, das Instrument der Schande und des Todes, wird zum Zeichen des Sieges über Tod und Sünde. Wie der Apostel Paulus schreibt: „Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat“ (Kol 2,14).
In der armenischen Tradition wird dieser Sieg im Kreuz besonders in der Karwoche ausgedrückt, wo das Kreuz nicht nur als Ort des Leidens, sondern als Thron der Herrlichkeit verehrt wird, von dem aus Christus über Tod und Hölle triumphiert.
Die theologische Bedeutung des Kreuzes
Das Kreuz Christi ist nicht nur ein historisches Ereignis, sondern ein theologisches Mysterium mit vielfachen Dimensionen:
1. Das Kreuz als Offenbarung der Liebe Gottes
Im Kreuz zeigt sich die Tiefe der göttlichen Liebe. „Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab“ (Joh 3,16). Diese Liebe ist nicht sentimental oder abstrakt, sondern konkret und kostbar – sie gibt sich selbst hin bis zum Äußersten.
Der heilige Johannes schreibt: „Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat“ (1 Joh 3,16). Das Kreuz wird so zum höchsten Maßstab der Liebe – einer Liebe, die sich selbst verschenkt, ohne Rücksicht auf den Preis.
In der armenischen Tradition wird diese Liebe besonders in den Hymnen der Karwoche besungen, die das Paradox des leidenden Gottes in poetischer Sprache ausdrücken: „Vor Deinem Kreuz Christus werfen uns nieder… und deine Auferstehung verherrlichen wir…“
2. Das Kreuz als Sühne für die Sünde
Seit den frühesten Tagen hat die Kirche das Kreuz als Sühneopfer für die Sünde verstanden. „Ihn hat Gott dazu bestimmt, Sühne zu leisten mit seinem Blut, Sühne, wirksam durch Glauben“ (Röm 3,25).
Doch dieses Sühneverständnis muss richtig interpretiert werden. Es geht nicht um einen rachsüchtigen Gott, der durch Leiden besänftigt werden muss, sondern um die Wiederherstellung einer zerbrochenen Beziehung. Die Sühne geschieht nicht gegen den Willen Gottes, sondern ist selbst Gottes Initiative in Christus: „Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat“ (2 Kor 5,19).
Der Kirchenvater Gregor von Nazianz (ca. 329-390) betont, dass Christus nicht für Gott, sondern von Gott geopfert wird – als Ausdruck der göttlichen Liebe, nicht als ihre Voraussetzung. Dies wird besonders in der Liturgie im Surb Patarag sichtbar, wo der Priester in seinen leisen Gebeten es zum Ausdruck bringt, dass die eucharistische Darbringung ein Opfer ist, in dem Christus selbst, „der Darbringende und der Dargebrachte, der Empfangende und der Austeilende“ ist.
3. Das Kreuz als Sieg über das Böse
Eine weitere wichtige Dimension ist der Sieg über die Mächte des Bösen. Das Kreuz ist nicht nur ein Akt der Sühne, sondern ein kosmischer Kampf, in dem Christus über Sünde, Tod und teuflische Mächte triumphiert.
In der östlichen Tradition wird dieser Aspekt besonders betont. Johannes Chrysostomos (ca. 349-407) beschreibt das Kreuz als die Waffe, mit der Christus den Tod besiegt – nicht durch rohe Gewalt, sondern durch Selbsthingabe und Liebe.
Irenäus von Lyon (ca. 135-202) entwickelt das Konzept der recapitulatio (Zusammenfassung): In Christus wird die gesamte Menschheitsgeschichte zusammengefasst und neu ausgerichtet. Wo Adam fiel, ist Christus gehorsam bis zum Tod. Durch diese Umkehrung wird die Macht der Sünde gebrochen.
4. Das Kreuz als Weg zur Nachfolge
Das Kreuz ist nicht nur ein einmaliges Ereignis in der Vergangenheit, sondern ein bleibender Maßstab für die Nachfolge. Jesus selbst sagt: „Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach“ (Mt 16,24).
Die frühen Christen verstanden das Martyrium als höchste Form dieser Nachfolge – als vollkommene Gleichgestaltung mit dem gekreuzigten Christus. Doch auch jenseits des Martyriums ist jede Form des Leidens um der Liebe und Gerechtigkeit willen eine Teilhabe am Kreuz Christi.
In der armenischen Geschichte, die von Verfolgung und Leiden geprägt ist, hat dieses Verständnis des Kreuzes als Weg der Nachfolge eine besondere Bedeutung. Das Kreuz wird zum Symbol der Treue in Zeiten der Prüfung und zum Zeichen der Hoffnung auf die letztendliche Rechtfertigung durch Gott. Das Kreuz ist zudem in der armenischen Tradition meist als ein blühendes Holz, welches die Hoffnung zum Ausdruck bringt, dass durch die Auferstehung Christi der Tod besiegt wird und alles wieder zum Leben erwacht.
Das Paradox des heilsamen Leidens
Das Kreuz Christi stellt die menschliche Weisheit vor ein Paradox, das philosophisch herausfordernd bleibt:
1. Kierkegaards Verständnis des Kreuzes als „Ärgernis“
Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard (1813-1855) beschreibt das Kreuz als skandalon – als Ärgernis und Stolperstein für die menschliche Vernunft. In seinem Werk „Einübung im Christentum“ betont er, dass der Glaube an den Gekreuzigten ein Sprung über den Abgrund der Vernunft erfordert.
Das Ärgernis liegt gerade darin, dass Gott selbst die Gestalt des Leidenden annimmt. Für Kierkegaard ist dies die tiefste Offenbarung der göttlichen Liebe: Gott wird nicht nur Mensch, sondern der niedrigste aller Menschen – der Verachtete und Gekreuzigte.
Dieser Gedanke entspricht der Paradoxie, die Paulus ausdrückt: „Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit; uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft“ (1 Kor 1,18).
2. Dostojewskis Vision des leidenden Gottes
Der russische Schriftsteller Fjodor Dostojewski (1821-1881) ringt in seinen Werken mit der Frage des Leidens und seiner Bedeutung. In seinem Roman „Die Brüder Karamasow“ lässt er Iwan die Frage stellen, ob irgendein zukünftiges Glück das unschuldige Leiden eines Kindes rechtfertigen könne.
Die Antwort findet sich nicht in abstrakten Theorien, sondern in der Person des leidenden Christus. Der staretz Sosima sagt: „Die Liebe ist ein hartes und furchtbares Ding.“ Sie kostet etwas – sie erfordert Opfer und Leiden. In Christus wird Gott selbst zum Teilhaber am menschlichen Leiden und transformiert es von innen her.
Diese Vision eines leidenden Gottes ist nicht eine nachträgliche Rechtfertigung des Leidens, sondern seine Überwindung durch Teilhabe und Verwandlung.
3. Die existenzielle Bedeutung des Kreuzes
Für den Menschen des 21. Jahrhunderts stellt sich die Frage nach dem Sinn des Leidens mit besonderer Dringlichkeit. In einer Kultur, die oft nach Wohlbefinden und Selbstverwirklichung strebt, erscheint das Kreuz als Provokation.
Doch gerade in seiner Provokation liegt seine Relevanz. Das Kreuz erinnert uns daran, dass wahres Leben und wahre Liebe immer Hingabe und Opfer einschließen. Wie Jesus sagt: „Wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden“ (Mt 16,25).
Das Kreuz bietet keine einfachen Antworten auf die Frage nach dem Leid, aber es zeigt uns einen Gott, der mit uns leidet und uns in unserem Leiden nicht allein lässt. Es offenbart eine Liebe, die stärker ist als der Tod, und einen Sinn, der tiefer liegt als unser momentanes Glück oder Unglück.
Praktische Übungen für die Fastenzeit
Das Kreuz Christi lädt uns ein, unser eigenes Leben und Leiden in einem neuen Licht zu sehen. Hier sind einige konkrete Übungen für diese Woche der Fastenzeit:
1. Betrachtung des Kreuzes
Nimm dir Zeit für eine bewusste Betrachtung des Kreuzes. Setze dich vor ein Kreuz – sei es ein Kruzifix in deinem Zuhause oder in einer Kirche – und verweile in Stille. Betrachte die Gestalt des Gekreuzigten und lass seine Bedeutung auf dich wirken.
Diese Übung der Betrachtung kann dir helfen, das Kreuz nicht nur als abstraktes Symbol, sondern als konkretes Zeichen der Liebe Gottes zu verstehen.
2. Verbindung von eigenem Leiden mit dem Kreuz Christi
Jeder Mensch erfährt in seinem Leben Leiden – sei es körperlicher, emotionaler oder geistlicher Art. Die Fastenzeit lädt uns ein, unser eigenes Leiden bewusst mit dem Leiden Christi zu verbinden.
Wenn du in dieser Woche Schmerz, Enttäuschung oder Schwierigkeiten erlebst, versuche, sie nicht nur als sinnlose Last zu sehen, sondern als Möglichkeit, am Leiden Christi teilzuhaben. Der heilige Paulus drückt diesen Gedanken so aus: „Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben, was an den Leiden Christi noch fehlt“ (Kol 1,24).
Diese Verbindung bedeutet nicht, das Leiden zu verherrlichen, sondern ihm im Licht des Kreuzes einen tieferen Sinn zu geben.
3. Solidarität mit den Leidenden
Das Kreuz Christi ist ein Aufruf zur Solidarität mit allen, die leiden. Jesus identifiziert sich mit den Geringsten seiner Brüder und Schwestern: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 25,40).
Überlege, wie du in dieser Woche konkret Solidarität mit Leidenden zeigen kannst – sei es durch Besuche bei Kranken, Hilfe für Bedürftige oder Einsatz für Gerechtigkeit. Diese praktische Nächstenliebe ist eine Form der Kreuzesnachfolge.
In der armenischen Tradition sind die Werke der Barmherzigkeit eng mit der Fastenzeit verbunden. Das Fasten soll nicht nur ein persönlicher Verzicht sein, sondern Ressourcen freisetzen für die Unterstützung der Bedürftigen.
Gebet vor dem Kreuz
Herr Jesus Christus, leidender Gottesknecht,
du hast das Kreuz auf dich genommen
aus Liebe zu uns und zur ganzen Welt.
In deinen Wunden finden wir Heilung,
in deinem Tod neues Leben,
in deiner Hingabe unsere Erlösung.
Hilf mir, das Kreuz nicht zu fürchten,
sondern als Zeichen deiner Liebe zu verstehen.
Lehre mich, wie du zu lieben –
nicht mit Worten allein, sondern mit meinem Leben.
Wenn ich leide, lass mich nicht verzweifeln,
sondern in meinem Schmerz deine Nähe erfahren.
Wenn andere leiden, öffne mein Herz für ihre Not
und meine Hände für helfendes Tun.
In dieser Fastenzeit führe mich tiefer in das Geheimnis
deines Kreuzes ein, damit ich
am Ostersonntag die volle Freude
deiner Auferstehung erfahren kann.
Amen.
Vom Kreuz zum Licht
Das Kreuz steht im Zentrum der Fastenzeit, aber es ist nicht ihr Ende. Es weist über sich hinaus auf die Auferstehung – auf den Ostersieg, der dem Leiden seinen letzten Sinn gibt. Wie ein armenisches geistliches Lied sagt: „Das Kreuz ist der Schlüssel, der uns die Tür zum Leben öffnet.“
In unserer vierten Fastenwoche stehen wir am Kreuzweg und blicken auf den leidenden Gottesknecht. Wir erkennen in seinem Leiden die tiefste Offenbarung der Liebe Gottes und die radikalste Lösung für das Problem des Bösen. Nicht durch Gewalt und Vergeltung, sondern durch Hingabe und Liebe überwindet Gott die Macht der Sünde und des Todes.
Als wir diese Fastenwoche begannen, haben wir über den barmherzigen Samariter nachgedacht – über die Frage, wer unser Nächster ist. Nun sehen wir in Christus, dem leidenden Gottesknecht, den ultimativen „Nächsten“ – denjenigen, der sich vollkommen mit unserem Leiden identifiziert hat und uns in unserer Not beisteht.
Pfr. Dr. Diradur Sardaryan