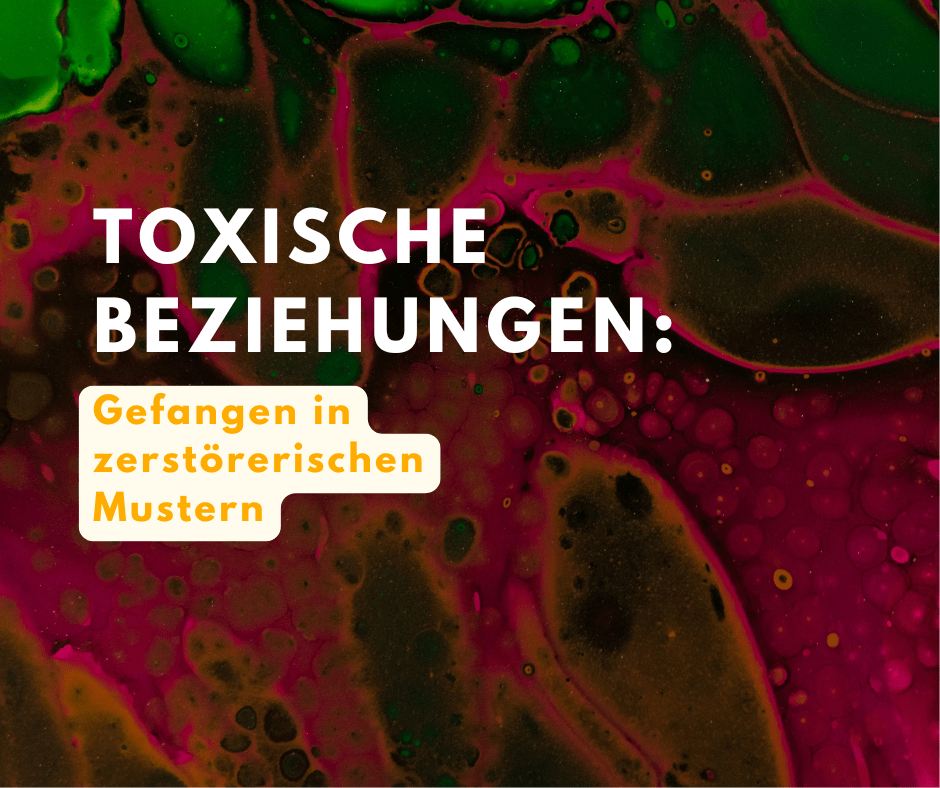Toxische Beziehungen:
Gefangen in zerstörerischen Mustern
Ein Beitrag zur Großen Fastenzeit 2025
von Pfr. Dr. Diradur Sardaryan
Gemeindepfarrer
Die Ikone des Abstiegs Christi in die Unterwelt zeigt einen kraftvollen Moment: Der auferstandene Christus steht über den zerbrochenen Toren der Hölle und zieht Adam und Eva eigenhändig aus ihren Gräbern. Er befreit sie aus einer Gefangenschaft, die sie selbst nicht überwinden konnten. Dieses Bild der Befreiung spricht tief in unsere menschliche Erfahrung hinein – besonders für jene, die in toxischen Beziehungen gefangen sind.
Die verborgenen Ketten erkennen
In der Seelsorge begegnen wir regelmäßig Menschen, die in Beziehungen gefangen sind, die ihre Würde, ihre Gesundheit und ihren Glauben untergraben. Oft erkennen die Betroffenen selbst nicht das volle Ausmaß ihrer Situation. Wie der heilige Ephräm der Syrer betet: „Herr und Gebieter meines Lebens, gib mir nicht den Geist der Trägheit, der Verzagtheit, der Herrschsucht und der Geschwätzigkeit.“ Diese vier Geisteshaltungen beschreiben präzise die Dynamiken toxischer Beziehungen: Passivität, Hoffnungslosigkeit, Kontrolle und Manipulation durch Worte.
Was genau macht eine Beziehung „toxisch“? Die moderne Psychologie und die geistliche Tradition der Kirche bieten ergänzende Perspektiven:
Psychologische Merkmale toxischer Beziehungen
Aus psychologischer Sicht zeichnen sich toxische Beziehungen durch bestimmte wiederkehrende Muster aus. Charakteristisch ist ein chronisches Ungleichgewicht von Geben und Nehmen, bei dem ein Partner konstant mehr investiert, ohne entsprechende emotionale Rückerstattung zu erhalten. Dieses Ungleichgewicht wird oft durch Kontrolle und Manipulation aufrechterhalten – der dominierende Partner bestimmt über Entscheidungen, Kontakte und sogar persönliche Überzeugungen des anderen, wobei gesunde Grenzen systematisch missachtet werden.
Ein besonders schädliches Element toxischer Dynamiken ist das kontinuierliche Untergraben des Selbstwertgefühls. Durch explizite oder subtile Kritik, durch Vergleiche mit anderen oder durch das Infragestellen der Wahrnehmung des Betroffenen entsteht ein Zustand der Verunsicherung und Selbstzweifel. Diese Verunsicherung wird oft verstärkt durch die schrittweise Isolation von Freunden, Familie oder Gemeinde, wodurch dem Betroffenen wichtige Außenperspektiven und Unterstützungssysteme entzogen werden.
Die Unberechenbarkeit des Verhaltens – der oft abrupte Wechsel zwischen Zuneigung und Ablehnung – führt zu einem Zustand permanenter Anspannung. Die Betroffenen entwickeln eine Hypervigilanz, eine ständige Wachsamkeit gegenüber Stimmungsschwankungen des Partners, die enorme psychische Energie kostet. Problematisch ist zudem die Leugnung oder Verharmlosung von Problemen, wenn der kontrollierende Partner Kritik abwehrt oder die Realität umdeutet.
In fortgeschrittenen Stadien können toxische Beziehungen auch von emotionaler oder physischer Gewalt geprägt sein, wobei auf Übergriffe oft Phasen intensiver „Wiedergutmachung“ folgen – ein Muster, das als „Gewaltkreislauf“ bekannt ist und die Betroffenen in einer Hoffnung auf Besserung gefangen hält.
Die geistliche Dimension aus ostkirchlicher Sicht
Die Kirchenväter kannten den Begriff „toxisch“ zwar nicht, beschrieben aber präzise die geistlichen Dynamiken destruktiver Beziehungen. Der heilige Johannes Chrysostomos spricht von der „Tyrannei der Leidenschaften“, die Menschen nicht nur vor Gott, sondern auch voreinander in Unfreiheit führt. Im Zentrum toxischer Beziehungen stehen oft grundlegende geistliche Probleme.
Der Stolz manifestiert sich als das tiefe Bedürfnis, den anderen zu dominieren und die eigene vermeintliche Überlegenheit zu demonstrieren. Diese Haltung steht im direkten Widerspruch zur christlichen Tugend der Demut, die den anderen höher achtet als sich selbst. Eine weitere problematische Grundhaltung ist das Besitzdenken, bei dem der Partner nicht mehr als Ebenbild Gottes mit eigener Würde und Freiheit gesehen wird, sondern zum Objekt degradiert wird, das den eigenen Bedürfnissen zu dienen hat.
Hinter der Kontrolle steht oft eine tiefe Angst – die fundamentale Unfähigkeit zu vertrauen, sowohl dem Partner als auch Gott selbst. Diese Angst führt zu dem Versuch, durch Kontrolle Sicherheit zu schaffen, was jedoch letztlich in größerer Unsicherheit für alle Beteiligten resultiert. Nicht zuletzt spielt auch die Scham eine zentrale Rolle – das tiefe Gefühl der eigenen Unwürdigkeit, das entweder zu übermäßiger Abhängigkeit führen kann oder im Gegenteil zu dem Versuch, durch Abwertung anderer die eigene Scham zu kompensieren.
In der seelsorgerischen Praxis zeigt sich häufig, dass Betroffene toxischer Beziehungen ihre Situation durch ein verzerrtes Verständnis christlicher Werte rechtfertigen. Viele glauben, es sei ihre religiöse Pflicht, alles zu ertragen. Ein wichtiger Schritt zur Befreiung ist die Erkenntnis, dass wahre christliche Liebe immer die Würde des Menschen achtet und dass andauernde Herabwürdigung nicht dem göttlichen Willen entspricht.
Die verschiedenen Gesichter toxischer Beziehungen
Toxische Beziehungsmuster finden sich in vielen Kontexten – nicht nur in romantischen Partnerschaften, sondern auch in Familien, Freundschaften, Arbeitsbeziehungen und sogar im kirchlichen Umfeld.
In Partnerschaften können sich toxische Dynamiken auf vielfältige Weise manifestieren. Häufig beginnt eine Beziehung vielversprechend mit Aufmerksamkeit und Zuneigung, die jedoch nach einer Bindungsphase einem kontrollierenden Verhalten weicht. Die Kontrolle kann sich auf verschiedene Lebensbereiche erstrecken – Finanzen, Kleidung, soziale Kontakte, Arbeitsweise, sogar auf religiöse Praktiken. Besonders problematisch ist, wenn religiöse Texte oder Traditionen instrumentalisiert werden, um Kontrolle zu rechtfertigen, etwa durch einseitige Auslegung von Texten über „Unterordnung“ in der Ehe.
Eine andere Form toxischer Partnerbeziehungen ist durch emotionale Instabilität gekennzeichnet. Der Partner wechselt unvermittelt zwischen überschwänglicher Zuneigung und eisiger Ablehnung, wodurch ein Zustand permanenter emotionaler Unsicherheit entsteht. Manchmal werden Drohungen mit Selbstverletzung oder Suizid als Druckmittel eingesetzt, um den anderen zu bestimmten Verhaltensweisen zu zwingen. Dies führt dazu, dass ein Partner sich vollständig für das emotionale Wohlbefinden des anderen verantwortlich fühlt und eigene Bedürfnisse vernachlässigt.
Auch in Eltern-Kind-Beziehungen können toxische Muster entstehen, die bis ins Erwachsenenalter fortwirken. Erwachsene Kinder versuchen oft jahrzehntelang, die Anerkennung eines Elternteils zu gewinnen, der diese permanent verweigert oder an Bedingungen knüpft. Die emotionale Abhängigkeit kann so stark sein, dass sie andere Beziehungen beeinträchtigt – Partner und eigene Kinder leiden unter der emotionalen Abwesenheit des Betroffenen, der ständig um die Anerkennung des Elternteils ringt.
Besonders komplex ist die Situation, wenn toxische Dynamiken im geistlichen Kontext auftreten. Geistliche Autorität kann missbraucht werden, wenn Leitungspersonen (ob Geistliche oder Gemeindevorsteher) beanspruchen, besondere Eingebungen zu haben, die nicht hinterfragt werden dürfen. Kritik wird dann als mangelnder Glaube oder gar als „Angriff des Feindes“ gedeutet. Die Vermischung legitimer Autorität mit persönlichen Interessen und Machtbedürfnissen führt oft zu tiefgreifenden Vertrauenskrisen bei den Betroffenen, die sich nicht nur auf die konkrete Beziehung, sondern auf ihr gesamtes Gottesbild auswirken können.
Die Tradition der Kirche als Ressource für Heilung
Während die moderne Psychologie wertvolle Werkzeuge zur Identifizierung und Veränderung toxischer Muster bietet, enthält die ostkirchliche Tradition tiefe Weisheit zur geistlichen Dimension dieser Problematik. Einige zentrale Konzepte:
Apaschkharum oder Metanoia – mehr als nur Reue
Die Große Fastenzeit ruft zur metanoia auf – oft übersetzt als „Buße“ oder „Reue“, doch das griechische Wort bedeutet wörtlich „Sinneswandel“ oder „Umdenken“. Für Menschen in toxischen Beziehungen kann dies bedeuten:
- Erkennen der wahren Natur der Beziehung jenseits von Rechtfertigungen
- Überprüfung verinnerlichter falscher Überzeugungen („Ich verdiene nichts Besseres“)
- Unterscheidung zwischen authentischer Selbstaufopferung und selbstzerstörerischem Verhalten
Wahre Umkehr beginnt mit der Erkenntnis der Wahrheit – nicht nur über unsere Sünden, sondern auch über die Würde, die Gott uns verliehen hat.
Askese – die Befreiung des Willens
Die asketische Praxis der Ostkirche – Fasten, Gebet, Almosengeben – dient der Befreiung des Willens von Abhängigkeiten. Für Menschen in toxischen Beziehungen kann eine adaptierte Form der Askese helfen:
- Übungen zur Stärkung der Entscheidungsfähigkeit (kleine, tägliche Entscheidungen bewusst treffen)
- Praktiken zur emotionalen Regulierung (Jesusgebet in Momenten der Angst oder Verwirrung)
- Bewusstes Pflegen gesunder Beziehungen zur weiteren Gemeinschaft
Die Gemeinschaft der Heiligen als alternatives Beziehungsmodell
Die Heiligen zeigen uns authentische Liebe, die nicht kontrolliert oder manipuliert. Die heilige Maria von Ägypten etwa bietet ein kraftvolles Beispiel der Befreiung aus destruktiven Beziehungsmustern. Ihre Geschichte zeigt den Weg von der Gefangenschaft in ungesunden Bindungen zur wahren Freiheit in Christus.
Die Beichte als Raum der Wahrheit
Das Mysterium der Beichte bietet einen geschützten Raum, in dem die Wahrheit über toxische Beziehungen ausgesprochen werden kann. Ein erfahrener Beichtvater wird:
- Die Situation nicht bagatellisieren oder vorschnell zur Versöhnung drängen
- Die Verantwortung für Missbrauch klar beim Täter belassen
- Zwischen Vergebung (innere Haltung) und Versöhnung (praktischer Schritt, der Umkehr voraussetzt) unterscheiden
Aus meiner Praxis als Gemeindepfarrer kann ich sagen: Die Beichte ist kein Instrument, um Menschen in schädlichen Situationen festzuhalten, sondern ein Raum der Befreiung. Manchmal bedeutet echte Buße, sich aus einer destruktiven Beziehung zu lösen – nicht aus Hass, sondern aus der Erkenntnis, dass das gegenwärtige Muster dem göttlichen Plan für beide widerspricht.
Zwischen therapeutischer und geistlicher Begleitung
Die Komplexität toxischer Beziehungen erfordert oft sowohl professionelle therapeutische als auch seelsorgerische Begleitung. Die moderne Psychologie bietet evidenzbasierte Interventionen, während die geistliche Tradition tiefere Sinnfragen adressiert. Beide Ansätze ergänzen einander.
Ein orthodoxer Psychotherapeut erläutert: „Als Therapeut arbeite ich an konkreten Verhaltensänderungen und der Verarbeitung von Traumata. Als orthodoxer Christ verstehe ich jedoch, dass wahre Heilung auch eine geistliche Dimension hat – die Wiederherstellung des Gottesbildes im Menschen.“
Beispiele für komplementäre Ansätze:
Therapeutische Perspektive |
Geistliche Perspektive |
|---|---|
| – Erkennen von Grenzverletzungen und deren Auswirkungen |
– Wiederentdeckung der gottgegebenen Würde |
| – Aufarbeitung von Traumata durch evidenzbasierte Methoden |
– Heilung der „Seelenwunden“ durch die Mysterien |
| – Erlernen gesunder Kommunikations- und Beziehungsmuster |
– Wachstum in der Gemeinschaft der Kirche als Heilungsraum |
| – Strategien zur Selbstfürsorge und Selbstbehauptung |
– Unterscheidung zwischen egoistischem Individualismus und gesunder Selbstliebe im Licht des Evangeliums |
Die Große Fastenzeit kann ein besonders geeigneter Zeitpunkt sein, um diesen Heilungsweg zu beginnen – sie bietet einen strukturierten Rahmen für Reflexion, Umkehr und Erneuerung.
Wege aus der Gefangenschaft:
Praktische Schritte
Der Weg aus toxischen Beziehungen ist selten einfach oder geradlinig. Er erfordert Mut, Unterstützung und oft konkrete Schutzmaßnahmen. Die folgenden Schritte sind als Orientierung gedacht, nicht als vereinfachte „Lösung“:
Für Betroffene toxischer Beziehungen
Der erste und oft schwierigste Schritt ist das Erkennen der Realität. Viele Menschen in toxischen Beziehungen haben gelernt, problematische Verhaltensweisen zu relativieren oder sich selbst die Schuld dafür zu geben. Das Führen eines Tagebuchs kann helfen, Klarheit zu gewinnen – indem Vorfälle, eigene Gefühle und Reaktionen dokumentiert werden, entsteht ein objektiveres Bild der Situation. Der Austausch mit einer vertrauenswürdigen Person außerhalb der Beziehung kann zusätzlich helfen, die eigene Wahrnehmung zu überprüfen. Hilfreich ist auch, die eigene Situation anhand objektiver Kriterien für gesunde Beziehungen zu reflektieren, wie sie etwa in der Fachliteratur oder in Beratungsstellen vermittelt werden.
Bei physischer Gewalt muss die Sicherheit absolute Priorität haben. Es ist ratsam, mit professioneller Unterstützung einen Sicherheitsplan zu erstellen – welche konkreten Schritte sind im Notfall zu unternehmen, welche Dokumente sollten griffbereit sein, welche sicheren Orte gibt es? Die Kenntnis über rechtliche Schutzmöglichkeiten wie Näherungsverbote kann lebensrettend sein. Hilfreich ist auch, im Vorfeld sichere Orte und vertrauenswürdige Personen für Krisensituationen zu identifizieren.
Der Weg aus einer toxischen Beziehung erfordert Begleitung, sowohl professionelle Hilfe durch spezialisierte Beratungsstellen als auch seelsorgerische Unterstützung durch einen erfahrenen Geistlichen. Selbsthilfegruppen oder therapeutische Gruppen können zusätzlich helfen, Isolation zu überwinden und von den Erfahrungen anderer Betroffener zu lernen.
Ein wesentlicher Teil des Heilungsprozesses ist die innere Arbeit an verinnerlichten falschen Überzeugungen. Viele Betroffene haben Glaubenssätze wie „Ich glaube, ich bin nichts wert“ oder „Ich glaube, ich verdiene Bestrafung“ so tief verinnerlicht, dass sie als Wahrheit erscheinen. Das Erlernen gesunder Grenzsetzung und Selbstfürsorge sowie die Entwicklung einer neuen Identität jenseits der toxischen Beziehung sind zentrale Aspekte dieses Prozesses.
In all dem können spirituelle Ressourcen eine wichtige Stütze sein. Das Gebet und die Lesung der Heiligen Schrift können als Anker in emotionalen Stürmen dienen, die Gemeinschaft der Kirche kann praktischen und emotionalen Halt bieten, und die Beichte kann ein Ort der Wahrheit und Neuorientierung werden, an dem alte Verstrickungen gelöst und neue Wege erkannt werden können.
Für Menschen, die ihr eigenes Verhalten als toxisch erkennen
Die Kirche betont, dass Veränderung für jeden Menschen möglich ist. Der Kirchenväter beschreiben den Weg der Umkehr als schrittweisen Prozess des Loslassens destruktiver Muster.
Der erste Schritt zur Veränderung toxischen Verhaltens ist das Übernehmen von Verantwortung. Dies erfordert den Mut, die Wahrheit über das eigene Verhalten ohne Beschönigungen anzuerkennen. Es bedeutet, auf Ausreden wie „Ich wollte nur…“ oder „Wenn sie/er nicht…“ zu verzichten und stattdessen die konkreten Auswirkungen des eigenen Verhaltens auf andere ehrlich zu betrachten. Ein wesentlicher Teil dieses Prozesses ist der Verzicht auf Schuldzuweisungen an den Partner oder äußere Umstände.
Professionelle Hilfe ist auf diesem Weg unverzichtbar. Spezialisierte Therapieprogramme für Menschen mit kontrollierendem Verhalten können helfen, die tieferen Ursachen des problematischen Verhaltens zu verstehen und alternative Handlungsstrategien zu entwickeln. Wenn eigene unverarbeitete Verletzungen und Traumata zur Ursache des toxischen Verhaltens geworden sind, kann eine Traumatherapie notwendig sein. Besonders wichtig ist das Erlernen alternativer Verhaltensweisen und Kommunikationsmuster, die Respekt und Gleichwertigkeit fördern.
Parallel dazu kann eine geistliche Begleitung den Prozess der Veränderung unterstützen. Die regelmäßige Beichte bei einem erfahrenen Beichtvater schafft einen Raum der Selbstreflexion und Rechenschaft. Eine tiefere Auseinandersetzung mit dem christlichen Verständnis von Liebe und Demut kann helfen, problematische Beziehungsvorstellungen zu korrigieren. Geistliche Übungen können zudem die Entwicklung von Empathie fördern – der Fähigkeit, sich in die Situation und die Gefühle anderer hineinzuversetzen.
Ein entscheidender Schritt ist, dem anderen Menschen Freiheit zuzugestehen. Dies bedeutet, zu akzeptieren, dass der Partner oder Familienangehörige eigene Entscheidungen treffen darf, auch wenn diese nicht den eigenen Vorstellungen entsprechen. Es schließt ein, gesetzte Grenzen zu respektieren, selbst wenn diese schmerzhaft sind. Nicht zuletzt gehört dazu die Bereitschaft, die Konsequenzen des eigenen Verhaltens zu tragen – sei es in Form einer zeitweiligen oder dauerhaften Trennung, falls der Betroffene dies für notwendig hält.
Für die Gemeinde als Schutz- und Heilungsraum
Die Kirchengemeinde hat eine besondere Verantwortung, sowohl einen sicheren Raum für Betroffene zu bieten als auch zur Veränderung toxischer Muster beizutragen. Als geistliche Familie sind wir aufgerufen, Schutz, Heilung und Orientierung zu bieten.
Unverzichtbar ist eine fundierte Schulung für Seelsorger und Gemeindemitarbeiter. Sie sollten in der Lage sein, Anzeichen toxischer Beziehungen frühzeitig zu erkennen und angemessen auf Offenbarungen von Missbrauch zu reagieren. Dazu gehört auch die Kenntnis über Weitervermittlungsmöglichkeiten an spezialisierte Hilfsangebote, wenn die Situation professionelle Unterstützung erfordert, die über die Möglichkeiten der seelsorgerischen Begleitung hinausgeht.
Ein wichtiger Beitrag der Gemeinde ist die Vermittlung eines gesunden Verständnisses christlicher Beziehungen. Dies schließt eine ausgewogene Interpretation biblischer Texte zu Ehe, Familie und zwischenmenschliche Beziehungen ein, die weder in Richtung eines missverstandenen Patriarchats noch in Richtung einer Auflösung traditioneller Werte tendiert. Besonders wichtig ist die deutliche Unterscheidung zwischen selbstloser Liebe im christlichen Sinne und selbstzerstörerischer Duldung von Missbrauch. Die Gemeinde kann zudem durch gesunde Beziehungsvorbilder innerhalb der Gemeinschaft positive Orientierung bieten.
Neben der geistlichen Dimension sollte eine christliche Gemeinde auch praktische Unterstützungsangebote bereitstellen oder vermitteln. Dies kann die Schaffung sicherer Zufluchtsmöglichkeiten für Betroffene umfassen, die Einrichtung begleiteter Gesprächsgruppen für Menschen in schwierigen Beziehungssituationen oder die Vermittlung zwischen professionellen Hilfsangeboten und kirchlicher Begleitung. Gerade für Mitglieder der Gemeinde, die möglicherweise sprachliche oder kulturelle Barrieren bei der Inanspruchnahme von Hilfsangeboten erleben, kann diese Brückenfunktion der Gemeinde entscheidend sein.
Nicht zuletzt ist ein klares Eintreten gegen jede Form von Missbrauch erforderlich. Die Gemeinde darf Gewalt in Beziehungen weder verharmlosen noch als reine Privatangelegenheit betrachten. Sie muss einerseits Täter zur Verantwortung ziehen und gleichzeitig Wege zur Umkehr aufzeigen. Besonderes Augenmerk sollte auf eine achtsame Sprache in Predigten und Gesprächen gelegt werden, die Opfer nicht zusätzlich belastet oder ihnen gar eine Mitschuld zuweist.

Die Ikone der Auferstehung als Hoffnungsbild
Die Große Fastenzeit führt uns Schritt für Schritt zum Osterfest – dem Fest der Befreiung schlechthin. Die Auferstehungsikone zeigt Christus, der Adam und Eva aus den Gräbern zieht. Dieses Bild kann für Menschen in toxischen Beziehungen eine kraftvolle Metapher sein:
- Christus selbst steigt in die „Unterwelt“ hinab – er begegnet uns in unseren dunkelsten Erfahrungen
- Er zertrümmert die Tore der Hölle – toxische Bindungen können durchbrochen werden
- Er ergreift Adam und Eva bei den Handgelenken – Befreiung ist ein Zusammenwirken göttlicher Initiative und menschlicher Bereitschaft
- Um sie steht die Gemeinschaft der Heiligen – Heilung geschieht in Gemeinschaft, nicht in Isolation
Eine Frau, die nach Jahren eine missbräuchliche Beziehung verlassen konnte, erzählt: „Während der Osternacht, als wir ‚Christus ist auferstanden‘ sangen, spürte ich zum ersten Mal seit langem: Auch für mich gibt es ein neues Leben. Die Ketten, die mich gefesselt hatten, waren zerbrochen. Nicht weil ich stark genug war, sondern weil Christus mich aus dem Grab gezogen hat, wie Adam und Eva auf der Ikone.“
Gebet für Menschen in toxischen Beziehungen
Barmherziger Christus,
der du in die Dunkelheit hinabgestiegen bist,
um die Gefangenen zu befreien,
blicke auf alle, die in zerstörerischen Beziehungen gefangen sind.Schenke ihnen Klarheit, die Wahrheit zu erkennen,
Mut, die notwendigen Schritte zu gehen,
und Menschen, die sie auf diesem Weg begleiten.Den Tätern schenke die Gnade der Einsicht und Umkehr,
den Betroffenen Heilung für die Wunden der Seele.Führe uns alle aus dem Grab der Unfreiheit
in das Licht Deiner Auferstehung.
Amen.
Reflexionsfrage: Welche Beziehungen in meinem Leben schenken Leben und Wachstum, welche nehmen Kraft und Würde? Wo bin ich aufgerufen, Grenzen zu setzen oder Verhaltensmuster zu verändern – sei es als Betroffener oder als jemand, der sein eigenes Verhalten überdenken sollte?
Infokasten: Hilfe bei toxischen Beziehungen
- Notfallnummern:
- Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 116 016 (kostenlos, mehrsprachig)
- Hilfetelefon Gewalt gegen Männer: 0800 1239900 (kostenlos)
- Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 (kostenlos)
- Beratungsangebote:
- Psychosoziale Beratungsstellen der Diakonie und Caritas
- Beratungsstelle ProFamilia
- Für orthodoxe Gläubige:
- Seelsorgerische Begleitung durch Priester nach Vereinbarung
Wichtig: In akuten Gefahrensituationen immer die Polizei (110) kontaktieren!