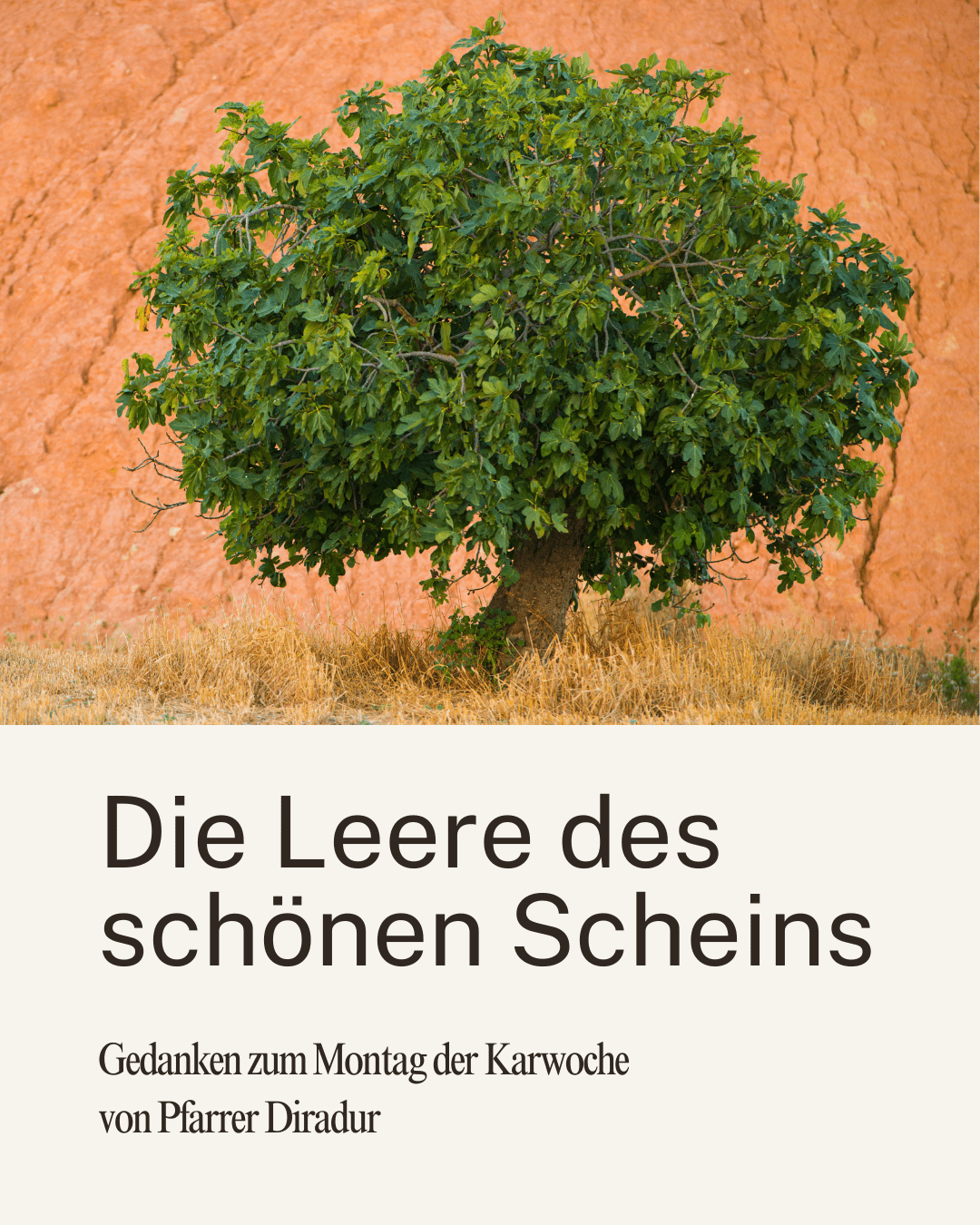Audioversion des Beitrags
Die Verfluchung des Feigenbaums
Als er am Morgen in die Stadt zurückkehrte, hatte er Hunger. Da sah er am Weg einen Feigenbaum und ging auf ihn zu und fand an ihm nichts als nur Blätter. Da sagte er zu ihm: In Ewigkeit soll keine Frucht mehr an dir wachsen. Und der Feigenbaum verdorrte auf der Stelle. Als die Jünger das sahen, fragten sie erstaunt: Wie konnte der Feigenbaum so plötzlich verdorren? Jesus antwortete ihnen: Amen, ich sage euch: Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, dann werdet ihr nicht nur das vollbringen, was ich mit dem Feigenbaum getan habe; selbst wenn ihr zu diesem Berg sagt: Heb dich empor und stürz dich ins Meer!, wird es geschehen. Und alles, was ihr im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt.
Nach dem Jubel des Palmsonntags begegnet uns heute ein anderer Christus: hungrig, konfrontativ, unbequem. Die Theologie der armenischen Kirche verbindet am Montag der Karwoche kosmische Ordnung mit existentieller Krise – und fordert uns heraus, über die Fruchtbarkeit unseres eigenen Lebens nachzudenken.
Der zweite Schöpfungstag, an dem Gott die Wasser schied und den Himmel erschuf, bildet den kosmologischen Rahmen. Diese erste grundlegende Trennung im Universum weist bereits hin auf das, was uns als Menschen ausmacht: die Fähigkeit zu unterscheiden – zwischen Frucht und Schein, zwischen Substanz und Leere.
In dieser Spannung stehen zwei Urgestalten der biblischen Überlieferung: Adam und Henoch. Der eine griff nach verbotener Frucht und verlor das Paradies; der andere brachte Frucht hervor und wurde lebendig in den Himmel aufgenommen. Zwei Wege des Menschseins, zwischen denen wir täglich wählen.
Wenn Christus den Feigenbaum verflucht (Mt 21,18-22), vollzieht er keinen Akt göttlicher Willkür. Es ist vielmehr das einzige zerstörerische Wunder Jesu – ein Zeichen, das wir besonders ernst nehmen sollten. Der Feigenbaum hatte Blätter, was in der Natur dieses Baumes ein Versprechen auf Früchte bedeutet, denn normalerweise erscheinen bei Feigenbäumen die Früchte vor den Blättern. Der mit Blättern geschmückte Baum gab vor, seiner Bestimmung nachzukommen, aber er täuschte den Hungrigen.
Dies ist mehr als eine Naturlektion – es ist ein prophetisches Zeichen. Wie im Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum (Lk 13,6-9) hatte Gott drei Jahre lang – die Jahre des öffentlichen Wirkens Jesu – auf Früchte bei seinem auserwählten Volk gewartet. Der Weingärtner (Christus) bat um Aufschub, wollte sich besonders um den Baum kümmern. Nun, kurz vor seiner Passion, zeigt Jesus durch die Verfluchung des Feigenbaums die Konsequenzen der beharrlichen Unfruchtbarkeit.
Die Gleichnisse, die folgen – von den zwei ungleichen Söhnen bis zu den bösen Weingärtnern – führen den Gedanken weiter: Nicht Worte und religiöse Gewänder zählen, sondern die Tat. Nicht das Erbe der Väter rettet, sondern die lebendige Begegnung mit dem Gottessohn.
Diese Geschichte richtet eine Frage an uns: Haben wir in der Vergangenheit so gelebt und gepredigt, Gespräche geführt, Sitzungen geleitet, also so als Christen gearbeitet, dass unsere Arbeit und unser Leben Früchte für die Ewigkeit hervorgebracht hat? Oder waren wir zu sehr auf das Schein, auf uns selbst konzentriert? Waren es nur Worte und viel zu wenig Taten?
Jesaja ruft uns zu: „Alles Fleisch ist wie Gras, und all seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich.“ Was bleibt von unseren beeindruckenden Projekten, unseren Gottesdienstbesuchen, theologischen Systemen, unseren kirchlichen Traditionen und Strukturen, wenn der hungrige Christus nach Frucht sucht?
Die Karwoche beginnt nicht mit Trost, sondern mit Konfrontation. Vielleicht liegt gerade darin die größte Barmherzigkeit: Noch ist Zeit, vom bloßen Schein zur wahren Frucht zu finden. Jesus spricht nicht von mehr Anstrengung, sondern von Glauben: „Habt Glauben an Gott!“ Es geht nicht darum, aus eigener Kraft Früchte hervorzubringen, sondern darum, Gott in uns wirken zu lassen.
Der Montag der Karwoche lädt ein zur existentiellen Inventur: Tragen wir nur Blätter, oder bringen wir Früchte hervor, die den Hunger Gottes und den Hunger der Welt stillen können?